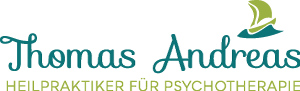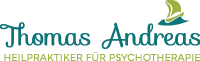„Wir leben zwar länger, sind von Tausenden von Menschen umgeben und mit Millionen anderer digital vernetzt – aber dabei möglichweise einsamer als jemals zuvor." (Mareike Ernst)
Was ist Einsamkeit?
Einsamkeit ist ein subjektiver Zustand emotionaler Not. Sie beschreibt die schmerzhafte Erfahrung, sich innerlich getrennt oder nicht zugehörig zu fühlen, unabhängig davon wie viele Menschen einen umgeben. Damit können tiefe Gefühle der Leere, Wertlosigkeit, Traurigkeit, Unverständnis, Frustration, Gefühl von Verlorenheit oder des Kontrollverlustes verbunden sein.
Einsamkeit ist jedoch ein weit verbreitetes menschliches Gefühl. In Deutschland wird der Anteil chronisch einsamer Menschen auf 5-15% geschätzt (Luhmann & Hawkley 2016, Reinwarth et al. 2023). Darüber hinaus fühlen sich bis zu 15% der Bevölkerung manchmal einsam (Entringer & Kröger 2020).
Wie entsteht Einsamkeit?
Der Wunsch nach Bindung, Verbundenheit und Zugehörigkeit ist ein angeborener und starker Antrieb der unser Verhalten, Emotionen und Kognition beeinflusst.
„Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist ein biologisches Grundbedürfnis." Baumeister und Leary (1995)
Einsamkeit kann während des ganzen Lebens auftreten. Sie entsteht, wenn das subjektive Gefühl nach Zugehörigkeit und Bindung bedroht wird. Das kann situativ in einzelnen Lebensmomenten und -abschnitten der Fall sein, aber auch chronisch bewusst/unbewusst das ganze Leben bestimmen.
Wenn die Einsamkeit schon früh im Leben erfahren wurde, kann sich daraus eine erhöhte Vulnerabilität (Verletzlichkeit) ergeben. Auch durch die transgenerationale Weitergabe nicht bearbeiteter traumatischer Erfahrungen der Eltern an das Kind kann dies mit einer erhöhten Vulnerabilität einhergehen. Das heißt, dass der Mensch in bestimmten sozialen Situationen, extrem empfindlich und sensibel reagiert und somit sehr leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen ist.
In welchen Situationen kann Einsamkeit auftreten?
In praktisch allen Situationen, in denen das Gefühl auftritt, dass andere Menschen uns ablehnen, ausschließen. Auch durch soziale Isolation und andere äußere Faktoren.
Wichtig ist hierbei, dass es immer ein subjektives Gefühl ist, somit kann eine Situation von Menschen völlig unterschiedlich erlebt werden. Für die einen ist eine „hochgezogene Augenbraue" bei einem anderen Menschen ein Grund zum Lachen und für die anderen ist es eine existenzbedrohliche Situation. Die einen ziehen in eine neue Stadt, haben keine Kontakte und sind trotzdem zuversichtlich und zufrieden, während die anderen ein emotionales Tief erleben.
„Einsamkeit ergibt sich aus der wahrgenommenen Lücke zwischen den gewünschten und den tatsächlich vorhandenen Beziehungen." Perlman und Peplau (1981)
Beispiele:
Im pränatalen (vorgeburtlichen) Bereich können es Krankheiten der Mutter, Stress und emotionale Herausforderungen, aber auch direkte Ablehnung (z.B. kein Wunschkind, unpassende Zeit, ungewollte Schwangerschaft) sein.
Im frühkindlichen Bereich können es Einzelereignisse sein (Trennung/Verlusterfahrungen von Bezugspersonen) oder auch anhaltende Ereignisse (z.B. das Kind wurde nie/selten in den Arm genommen, Vernachlässigung). Auch Krankheiten, Krankenhausaufenthalte, äußere Ereignisse bei den Bezugspersonen, staatlich bedingte Vorgaben (z.B. DDR – zu frühe Kindergrippenzeit), die es unmöglich machten, sich liebevoll um das Kleinkind zu kümmern.
In späteren Kindheitsphasen kann es bei emotionalem Missbrauch, körperliche Gewalt, sexueller Missbrauch oder Mobbing-Erfahrungen auftreten. Aber auch indirekt durch fehlende Spielpartner/Freunde, Trennung und Scheidungen der Eltern, häufige Umzüge/Schulwechsel und weitere Faktoren.
Im Erwachsenenalter können auch soziale Isolation (z.B. Wohnortwechsel, Krankheiten, Lebensveränderungen wie Verlust des Arbeitsplatzes, Renteneintritt), Mobbingerfahrungen, Trennungen, Scheidungen und Verluste die Gefühle der Einsamkeit hervorrufen.
Einsamkeit ist ein normales Gefühl
Praktisch alle Primäremotionen werden bis zum 12. Lebensmonat ausgebildet (z.B. Freude, Angst, Wut/Ärger, Trauer, Neugier). Weitere Emotionen bzw. die Differenzierung werden im späteren Leben durch Lern- und Konditionierungsvorgänge erlernt. Es ist somit natürlich, dass diese Emotionen auftreten, sie gehören zu unserem menschlichen Dasein.
Dazu ein Beispiel:
Ein 1- bis 2-jähriges Kind kommt in die Kindergrippe. Die Eltern sind ganz liebevoll und kümmern sich aufrichtig um ihren Sprössling. Die Zeit von der Geburt bis dahin, war geprägt von viel Nähe, Liebe, Sicherheit und Vertrauen durch die Eltern. Doch wie es manchmal so ist, die Eltern habe natürlich auch Kosten und berechtigterweise auch eigene Bedürfnisse, Ziele und Wünsche für ihr Leben. Die Miete muss bezahlt werden, die Ernährung gesichert, das Auto finanziert werden, es geht auch mal etwas kaputt usw. Also ganz normale Dinge.
Für das Kleinkind stellt sich die Situation aber anders dar. Es kann die Kausalität zwischen „Eltern müssen Geld verdienen" und dem „Beginn der Kindergrippe" nicht erfassen. Es ist kognitiv nicht in der Lage die Zusammenhänge zwischen den Ereignissen herzustellen. In dieser Situation merkt das Kleinkind nur, etwas hat sich geändert. Vielleicht stellt es sich dann die Frage auf emotionaler Ebene „Was habe ich falsch gemacht? Bin ich ein böses Kind? Mama hat mich nicht mehr lieb! Mama lässt mich im Stich!". In dieser Situation kann das Kind Einsamkeit fühlen und es ist berechtigt und sinnvoll dies zu fühlen. Es bemerkt die unangenehmen Gefühle und den Schmerz, weil hier die Bindung bedroht ist.
Im Idealfall kümmert sich die Erzieherin liebevoll um das Kind. Die Eltern kommen nach der Arbeit wieder vorbei, trösten das Kind und schenken Liebe, Vertrauen und körperliche Nähe. Die Eltern versuchen nicht die Gefühle zu ignorieren oder zu bagatellisieren („Es ist doch gar nicht so schlimm", „Stell dich nicht so an."), sondern sie geben ihrem Kind das Gefühl, dass es „OK ist, wie es ist und wie es fühlt.".
Das Kind merkt dann, es war doch alles nicht so schlimm – Mama ist wieder da. Es lernt auf diese Art und Weise einen konstruktiven Umgang mit dem Gefühl der Einsamkeit. Das Gefühl ist da, aber es bedeutet nicht, dass die Bindung verlorengeht. In der weiteren Kindergrippenzeit lassen dann die Gefühle der Einsamkeit immer mehr nach. Das Kind hat gelernt, dass es nicht verlassen wird, also die Bindung durch die Kindergrippe nicht gefährdet ist. Aber auch, dass die Gefühle willkommen sind.
Was bewirkt Einsamkeit?
Im oben genannten Beispiel wurde ein konstruktiver Umgang mit Einsamkeit in der frühesten Kindheit gefunden. Doch wenn es Situationen gab, also wo das Zugehörigkeitsgefühl als gefährdet/existenzbedrohend wahrgenommen wurde und nicht angemessen verarbeitet und aufgefangen wurde, so kann dies prägenden Einfluss auf das ganze Leben nehmen. Es wird dann Bestandteil der Persönlichkeit (z.B. „Ich bin nicht gut genug => Mama hat mich nicht lieb!") und somit Einfluss auf das Denken, Fühlen und Handeln.
Unser Bindungssystem ist lebenslang darauf ausgerichtet, unter Stress oder Bedrohung Nähe zu bedeutsamen Menschen zu suchen. Ein Kind entwickelt Strategien um diese unangenehmen Gefühle nicht mehr zu fühlen und gleichzeitig die Bindung zu den Bezugspersonen aufrechtzuerhalten. Diese sogenannten Überlebensstrategien werden solange beibehalten, bis sie ins Bewusstsein rücken. Dies geschieht oft in emotionalen Krisen und Herausforderungen, denen wir im Leben begegnen. Wir erleben zwar die aktuelle Situation, die Gefühle und der Umgang damit kommt aber aus der tiefsten Vergangenheit.
Die eine Strategie ist die hyperaktive Suche nach Nähe und die Betonung der mangelnden Bedürfnisse von Sicherheit und Nähe. Solche Menschen finden sich oft in abhängigen oder co-abhängigen Beziehungen wieder („Ohne dich kann ich nicht leben.").
Eine andere Strategie ist die Spaltung/Unterdrückung der Bindungsbedürfnisse. Das sind dann diejenigen Menschen die sich eher aus sozialen Beziehungen zurückziehen, viel Distanz in Partnerschaften benötigen oder auch die komplette Vermeidung enger Beziehungen/Partnerschaften.
Beiden Strategien ist gemein, dass es sich um einen Nähe-Distanz-Konflikt handelt. Das Gefühl der Einsamkeit kann hierbei verhindert werden. In Kombination mit persönlichen (biologisch, genetisch) Faktoren, der Beziehungsgestaltung durch die Bezugspersonen, Umwelt- und weiteren Faktoren kann sich das dann wie folgt auswirken:
- Unter Stress oder Bedrohung wird keine Nähe zu anderen Menschen gesucht („Mir geht's gut. Das Wetter/Job ist …")
- Es bestehen Schwierigkeiten, Hilfe anzunehmen („Ich brauch keine Hilfe. Ich bekomme das alleine hin.")
- Gefühle werden nicht wahrgenommen oder artikuliert („Ich war noch nie wütend/traurig")
- der/die andere Person ist für die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse zuständig ist
- vermindertes Selbstwertgefühl („Ich bin nicht liebenswert", „Ich bin nicht gut genug", Minderwertigkeitskomplexe)
- wenig Selbstvertrauen („Ich schaffe/kann das nicht.", „Ich bin zu doof", pessimistische Zukunftssicht)
- wenig Selbstwirksamkeit (keine Ziele und Wünsche, Prokrastination [ständiges Aufschieben])
- der Zugang zu sich selbst und den eigenen Bedürfnissen ist verlorengegangen
- es kann keine Verbundenheit mit anderen Menschen gespürt und gefühlt werden
- erhöhte Aufmerksamkeit für soziale Signale (reagieren sensibler auf negative Signale), dabei werden diese aber weniger präzise wahrgenommen
- Tendenz sich zurückziehen
- das Verhalten anderer auf sich zu beziehen ist erhöht („Ich habe Schuld.") oder umkehrt („Die anderen haben Schuld")
- das Leben wird durch dysfunktionale selbsterfüllende Prophezeiungen gestaltet („Das hat doch alles keinen Zeck", „Mich mag eh niemand")
- ein genereller unbewusster Lebensunwille prägt das Denken, Fühlen und Handeln
- Neigung zu körperlicher Inaktivität, ungesunder Ernährung, Alkohol- und Tabakkonsum (Hawkley & Cacioppo 2003)
Auch Perfektionismus steht in seiner Gesamtheit mit Einsamkeit und Depressionssymptomen im Zusammenhang, indem er Gefühle der Unverbundenheit mit anderen hervorruft. Das kann die Neigung sein, sich selbst übertriebene Standards und Erwartungen zu setzen, die Überanpassung (den Erwartungen und Normen anderer gerecht zu werden) oder auch der hohe Anspruch auf Leistungen und Verhalten anderer Menschen.
Des Weiteren besteht eine stärkere Zustimmung zu allgemeinen Verschwörungstheorien, politischer Radikalisierung und antidemokratischen Einstellungen (z.B. Rassismus, Populismus, Rechtsextremismus). Personen wiesen mehr Aggression und Unterwürfigkeit gegenüber starken Führungspersönlichkeiten auf. Sie waren weniger optimistisch was die Zukunft anging und hatten den Eindruck diese weniger gestalten zu können. (Progressive Zentrum et al. 2023; Zick, Küpper und Mokros 2023).
Was ist der Unterschied zwischen Depression und Einsamkeit?
Im Diagnosemanual ICD-11 gibt es keine Differenzierung zwischen Depression und Einsamkeit. Hier wird unterschieden zwischen leichter, mittlerer und schwerer Depression.
Beiden ist gemein, dass es sich um ein dysphorisches Erleben handelt. Es bestehen wechselseitige Beziehungen, wobei Einsamkeit die Depression begünstigt und die Depression wieder die Einsamkeit. Depressive Symptome wie Energie- und Interessenverlust, verminderte Aktivität und sozialer Rückzug begünstigen Einsamkeit. Andererseits impliziert Einsamkeit auch Traurigkeit, Selbstzweifel, Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung.
Einsamkeit und Gesundheit
Dauerhafte bzw. langfristige Einsamkeit hat negative Wirkungen auf die psychische Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden (Park et al. 2020).
- Einsamkeit, Depression und soziale Ängste/Phobien stehen in engem Zusammenhang
- Das Risiko an einer Depression zu erkranken ist um 18% erhöht.
- Es besteht ein um 34,8% höheres Risiko ängstlich zu sein
- Zusammenhänge bestehen zu Schizophrenie, Suizidgedanken, selbstschädigenden Verhalten und Zwangsstörungen
- Risikofaktor für Suchterkrankungen (Alkohol, Medikamente, Drogen, Internet- und Spielsucht)
- Risikofaktor für das Neuauftreten/Verschlimmerung verschiedener körperlicher Krankheiten (z.B. Volkskrankheiten, koronare Herzkrankheiten, Schlaganfall, Diabetes-Typ2)
- Schlafstörungen
- Mangelnde Selbstbeherrschung bei der Nahrungsaufnahme (z.B. Adipositas)
Zusammenfassung
Einsamkeit ist ein unangenehmes Gefühl und kann jeden Menschen treffen. Es ist kein Zeichen von Schwäche, Versagen oder persönlichen Scheitern. Sie ist evolutionär sinnvoll, weil sie uns darauf hinweist, dass uns etwas Überlebenswichtiges (Bindung, Zugehörigkeit) fehlt.
„Einsamkeit ist keine Störung. Sie ist ein menschliches Gefühl. Und wie jedes Gefühl darf sie ernst genommen werden."
Der Umgang mit Einsamkeit ist bei jedem Menschen individuell. Manche Menschen suchen intensiv Nähe, andere vermeiden sie ganz. Oft ist es ein ständiges inneres Ringen zwischen dem Wunsch nach Bindung und der Angst vor Zurückweisung.
„Glaube deinen Gedanken nicht. Frag dich lieber, woher die Gedanken kommen und wessen Stimme da spricht – Du bist nicht allein!"
Was kannst du gegen Einsamkeit tun?
Einsamkeit bewusst ansprechen
Such dir einen vertrauten Menschen und spreche deine Einsamkeit und deine Gefühle bewusst an. Verletzlichkeit und Gefühle zu zeigen, kann Nähe und Zugehörigkeit ermöglichen. Wenn du keinen Menschen in deiner Umgebung hast, dann darfst du auch gerne professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen.
Soziale Aktivitäten
- Gehe auf andere Menschen zu und versuche die Beziehung zu verbessern
- Reaktiviere deine Kontakte zu Freunden und Freundinnen
- Schenke anderen Menschen, denen du im Alltag begegnest ein freundliches Lächeln
- Melde dich bei Vereinen, Kursen etc. an, wo du in Kontakt mit anderen Menschen kommst
Persönliche Aktivitäten
- Denke über mögliche Lösungen nach und setze sie um
- Widme dich angenehmen Tätigkeiten die Spaß machen
- Werde körperlich aktiv (Das kann auch ein Spaziergang oder wild herumtanzen zur Lieblingsmusik im Wohnzimmer sein)
- Verbringe deine Zeit mit Haustieren
- Nutze Soziale Medien auf konstruktive Art und Weise (z.B. sich mit Gleichgesinnten in Foren austauschen)
- Nutze die Zeit für Selbstfürsorge (z.B. mit einer Umarmung, einem entspannenden Bad)
Achtsamkeit und Selbstreflexion
- Übe dich im Hier-und-Jetzt (z.B. Meditation, Qigong, Yoga)
- Hinterfrage deine eigenen Wahrnehmungen
- Schreibe in dein Tagebuch oder nutze andere krative Methoden um dich auszudrücken
- Erkenne die Tatsache an, dass sowohl positive als auch negative Emotionen Teil des menschlichen Lebens sind
Zusätzliche Informationen und telefonische Unterstützung
Abschließender Hinweis
Dieser Beitrag soll informieren und zum Nachdenken anregen.
Wenn du merkst, dass dich das Thema stark beschäftigt oder belastet – scheue dich nicht Kontakt zu mir aufzunehmen. Ich bin gerne für dich da.
„Ich sehne mich immer nach dem Alleinsein, aber bin ich allein, bin ich der unglücklichste Mensch." Thomas Bernhard
Quellen:
Mareike Ernst: Einsamkeit – Modelle, Ursachen, Interventionen